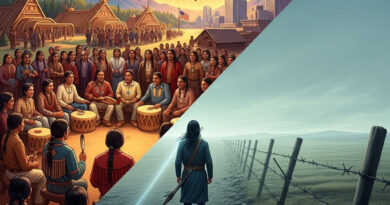Ausländerfeindlichkeit in Japan trotz niedrigem Ausländeranteil ein Wahlkampfschlager
Japan steht vor einer bedeutsamen Wahl, doch nicht Wirtschaft, Klima oder Digitalisierung bestimmen die Debatten – sondern das Thema „Ausländer“.
Das mag auf den ersten Blick überraschen: In kaum einem Industrieland ist der Anteil an ausländischer Bevölkerung so gering wie in Japan. Nur rund drei Prozent der Einwohner sind keine japanischen Staatsbürger. Dennoch wird rund um die Oberhauswahl im Juli 2025 mit einer auffälligen Schärfe gegen Ausländer mobilgemacht – sowohl von rechten Oppositionsparteien als auch zunehmend aus dem Regierungslager.
Diese Entwicklung wirft Fragen auf: Warum kann ausgerechnet in einem Land mit traditionell geschlossener Einwanderungspolitik und geringer tatsächlicher Migration eine solche Stimmung entstehen? Und warum funktioniert ausländerfeindliche Rhetorik als politisches Erfolgsrezept?
Wahlkampf 2025: Das Thema Einwanderung dominiert
Am 20. Juli 2025 findet in Japan die Wahl zum Oberhaus des Nationalparlaments statt. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) unter Premierminister Shigeru Ishiba geht dabei auf Konfrontationskurs mit einer neuen politischen Kraft: der rechtspopulistischen Partei Sanseito (参政党), die sich offen gegen Zuwanderung und internationale Einflüsse positioniert.
Die Sanseito, was sich mit „Partei der Mitbestimmung“ übersetzen lässt, ist nicht im klassischen Parteienspektrum Japans verankert. Vielmehr entstand sie während der Corona-Pandemie aus einer Mischung aus Impfgegnern, Nationalisten und Internetaktivisten. Ihr Generalsekretär, Sohei Kamiya, ein früherer Lokalpolitiker, ist mittlerweile ein Star in den sozialen Medien. Auf YouTube folgen ihm über 400.000 Menschen – Tendenz steigend.
„Japan gehört den Japanern“, sagt Kamiya in einem vielbeachteten Wahlkampfvideo. „Wir müssen unsere Grenzen schützen – gegen unkontrollierte Zuwanderung, gegen fremde Einflüsse und gegen Regierungen, die nur auf Globalisierung setzen.“
Wer sind die Sanseito – und warum sind sie erfolgreich?
Sanseito schöpft ihre Kraft nicht nur aus Kritik an der Einwanderung, sondern auch aus einer grundsätzlichen Ablehnung des etablierten Systems. Ihre Themenpalette reicht von Kritik an der WHO über Ablehnung der COVID-Maßnahmen bis zur Warnung vor einem angeblichen Ausverkauf japanischer Immobilien an chinesische Investoren.
Ein zentraler Punkt der Sanseito-Kampagne ist die „rücksichtslose Öffnung Japans für Ausländer“, wie sie es nennen. Vor allem Touristen und Gastarbeiter aus China, Vietnam oder den Philippinen werden zum Feindbild erklärt. So sagte ein Sprecher der Partei jüngst: „Wir sehen, wie unsere Straßen überfüllt sind, wie unsere Kultur verwässert wird. Das ist nicht mehr das Japan, das wir lieben.“
Zwar liegt der reale Ausländeranteil bei nur rund 3 %, doch die Angst vor „Überfremdung“ wird geschickt geschürt. Laut Umfragen (Reuters, Juli 2025) trauen 12–15 % der Wähler der Sanseito ihre Stimme zu – ein beachtlicher Wert für eine Partei, die erst 2021 gegründet wurde.
Reaktion der Regierung: Populismus mit staatlichen Mitteln
Premierminister Ishiba reagierte auf die Erfolge der Rechten mit einer überraschenden Maßnahme: Anfang Juli 2025 wurde eine neue „Behörde zur Kontrolle von Ausländerbelangen“ eingerichtet. Diese Stelle soll Beschwerden über Ausländer sammeln und an Polizei oder Einwanderungsbehörden weitergeben. Kritiker sprechen von einer „Institutionalisierung von Misstrauen“.
Die Regierung verteidigt sich: „Es geht nicht um Diskriminierung, sondern um die Wahrung der öffentlichen Ordnung“, erklärte Regierungssprecherin Sato auf einer Pressekonferenz. Doch der Zeitpunkt – kurz vor der Wahl – lässt tief blicken. Politikwissenschaftler Takuya Nishimura von der Universität Osaka meint dazu: „Die LDP übernimmt Teile der rechtspopulistischen Rhetorik, um ihre Wählerbasis nicht an Sanseito zu verlieren. Das ist ein gefährlicher Pakt mit dem Feuer.“
Ein Land mit Migrationshemmung
Japan gilt seit jeher als ein kulturell und sprachlich homogenes Land. Der Begriff „Nihonjinron“ beschreibt diese Selbstwahrnehmung als einzigartig, anders und exklusiv. Auch rechtlich ist Integration schwierig: Es gibt kaum Angebote für dauerhafte Einbürgerung oder doppelte Staatsbürgerschaft, die Sprache gilt als hohe Hürde, soziale Inklusion ist begrenzt.
Doch ausgerechnet diese kulturelle Abgrenzung verschärft die aktuelle Lage. Wer „nicht dazugehört“, fällt in Japan sofort auf – und wird häufig nicht als Teil der Gesellschaft gesehen, selbst nach Jahrzehnten im Land. Selbst sogenannte „Zainichi“ – koreanische Migranten in dritter Generation – haben oft keinen vollen Bürgerstatus.
Digitale Kanäle verstärken das Klima der Angst
Die politische Polarisierung findet nicht nur auf Wahlplakaten statt, sondern vor allem in sozialen Netzwerken. Auf YouTube, Twitter und Telegram mobilisieren Kanäle wie jener von Sohei Kamiya hunderttausende Menschen. Kurze Clips, in denen angebliche Übergriffe durch Ausländer oder aufrüttelnde Straßenszenen gezeigt werden, verbreiten sich viral – oft ohne faktische Grundlage.
Ein Beispiel: Im Juni 2025 kursierte ein Video, das eine Gruppe südkoreanischer Touristen zeigt, die angeblich eine ältere Japanerin bedrängen. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine gestellte Szene handelte – dennoch wurde das Video millionenfach angesehen und kommentiert. Der Tenor: „So sieht es heute in Kyoto aus – Dank offener Grenzen!“
Populismus auf westlichen Spuren
Die Sanseito nutzt Strategien, die westliche Populisten bereits erfolgreich angewendet haben. Das Narrativ „Japan First“ erinnert unweigerlich an „America First“ unter Donald Trump. Auch die Sprache („illegale Ausländer“, „globale Eliten“, „Volksverräter“) ähnelt frappierend der europäischen Rechten.
Dabei wirkt die Argumentation besonders perfide, weil sie nicht auf Fakten, sondern auf Emotionen basiert. So erklärte Kamiya in einer Rede: „Es ist nicht wichtig, ob sie viele oder wenige sind – es ist wichtig, dass sie nicht unsere Werte teilen.“ Eine Aussage, die klare Parallelen zu fremdenfeindlichen Aussagen europäischer Parteien wie AfD, Rassemblement National oder Lega Nord erkennen lässt.
Ökonomische Verunsicherung als Nährboden
Ein weiterer Faktor ist die wirtschaftliche Lage: Japans Bevölkerung altert rapide, das Land ist dringend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen – insbesondere in Pflege, Bau und Gastronomie. Gleichzeitig steigen Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise. Viele Menschen empfinden die Gegenwart als unübersichtlich – ein klassischer Auslöser für Sündenbocksuche.
So berichten konservative Lokalzeitungen immer wieder von „chinesischen Investoren“, die ganze Straßenzüge in Städten wie Osaka oder Fukuoka aufkaufen. Auch wenn diese Fälle real sind, werden sie medial stark überhöht – mit der Implikation: „Sie nehmen uns unser Land weg.“
Gefahr für Demokratie und Menschenrechte
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch warnen vor der politischen Instrumentalisierung von Migration. „Japan unterläuft grundlegende Standards internationaler Menschenrechte“, erklärte Amnesty-Asien-Direktor Joshua Rosenzweig im Juni 2025. „Die neu geschaffene Überwachungsstelle ist ein Rückschritt – sie legalisiert Diskriminierung.“
Auch innerhalb Japans regt sich Widerstand. In Tokio demonstrierten Ende Juni rund 5.000 Menschen gegen den Kurs der Regierung. Das Motto: „Japan ist bunt – kein Platz für Hass.“
Wenn Fakten nicht mehr zählen
Die aktuelle Debatte um Ausländer in Japan zeigt, wie politische Realitäten von Emotionen und Ängsten überlagert werden können. Die Zahl der ausländischen Bürger ist gering, ihr ökonomischer Beitrag hoch – doch das hilft wenig, wenn das politische Klima auf Polarisierung setzt.
Der Erfolg rechtspopulistischer Kräfte wie Sanseito ist ein Warnsignal – nicht nur für Japan, sondern für jede Demokratie: Wenn die Angst vor dem Anderen zur zentralen politischen Strategie wird, ist die Gesellschaft auf einem gefährlichen Weg. Ob es der Zivilgesellschaft gelingt, diese Entwicklung zu stoppen, wird sich nach der Wahl am 20. Juli zeigen.
Update nach der Wahl (20. Juli 2025):
Bei der Oberhauswahl erlitt die Regierungskoalition unter Ministerpräsident Ishiba eine schwere Niederlage: Laut ersten Auszählungen verlor die LDP zusammen mit ihrem Partner Kōmeitō nicht nur ihre Mehrheit im Unterhaus, sondern droht nun auch die Kontrolle im Oberhaus zu verlieren. Als Hauptgründe werden politische Unzufriedenheit mit der anhaltend hohen Inflation sowie der kontrovers diskutierten Zuwanderungspolitik genannt, von der rechtspopulistische Gruppierungen wie Sanseitō profitierten. Die historische Stärke der Opposition und der Zuwachs rechtspopulistischer Stimmen deuten auf eine Phase wachsender politischer Instabilität hin. Premier Ishiba kündigte an, im Amt zu bleiben, während Beobachter eine tiefgreifende Neuausrichtung der japanischen Politik für wahrscheinlich halten