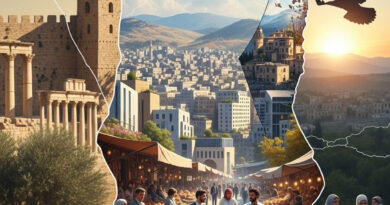Migrationspolitik: Irrtümer, Mythen und die Rolle der Wirtschaft
Die Debatte über Migration ist eines der politisch aufgeladensten Themen der Gegenwart. In Deutschland fordern Stimmen wie Alexander Dobrindt (CSU) schärfere Grenzkontrollen, Rückführungszentren außerhalb Europas und eine Reduzierung der Zuwanderung.
Gleichzeitig steht die deutsche Wirtschaft angesichts eines eklatanten Fachkräftemangels vor einem strukturellen Problem, das ohne Migration kaum lösbar erscheint. Zwischen politischen Symboldebatten und wirtschaftlicher Realität klafft eine wachsende Lücke. Dieser Artikel beleuchtet die gängigsten Mythen über Migration, stellt ökonomische Fakten gegenüber und erklärt, warum eine realistische und pragmatische Migrationspolitik im nationalen Interesse liegt.
Hintergrund & Rahmenbedingungen
Seit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015 sind etwa zwei Millionen Schutzsuchende nach Deutschland gekommen. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben sich die Asylzahlen seitdem stark verändert: Während 2015 rund 890.000 Asylanträge gestellt wurden, waren es 2023 knapp 329.000. Gleichzeitig kehren laut Bundesinnenministerium etwa 60 Prozent der Eingewanderten nach einigen Jahren wieder zurück – oft mangels Perspektive oder fehlender Integration in den Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig steigt der Fachkräftebedarf in Deutschland. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fehlen derzeit etwa 1,7 Millionen Arbeitskräfte, insbesondere in Branchen wie Pflege, Bau, Gastronomie und Logistik. Der wirtschaftliche Kontext lässt also eine ganz andere Lesart der Migrationsfrage zu als die, die in politischen Talkshows häufig dominiert.
Irrtümer und Mythen – was stimmt wirklich?
Mythos 1: „Migranten stehlen Arbeitsplätze“
Ein hartnäckiges Vorurteil ist die Annahme, Zuwanderung verdränge heimische Arbeitskräfte. Doch empirische Befunde zeichnen ein differenzierteres Bild. Der Migrationsforscher Hein de Haas stellt klar: „Die Vorstellung, Migration sei ein Nullsummenspiel, ist schlicht falsch. Zuwanderer schaffen durch Konsum neue Nachfrage, die wiederum neue Jobs erzeugt.“ Kurzfristig können einzelne Gruppen unter Lohnkonkurrenz leiden, etwa niedrigqualifizierte einheimische Arbeiter. Doch mittel- und langfristig ist der Effekt gering und meist sogar positiv für das BIP-Wachstum.
Mythos 2: „Geflüchtete leben dauerhaft auf Kosten des Staates“
Ein gängiges Argument gegen Aufnahmebereitschaft lautet, Geflüchtete seien eine finanzielle Belastung für den Steuerzahler. Zwar erhalten Asylbewerber in den ersten Monaten staatliche Unterstützung, doch zahlreiche Studien – darunter eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) – zeigen, dass sich Integration rechnet. „Das Märchen von der teuren Migration“ sei durch Fakten widerlegt, meint DIW-Präsident Marcel Fratzscher: „Zuwanderer zahlen im Durchschnitt mehr in die Sozialsysteme ein, als sie herausbekommen – spätestens ab dem zehnten Jahr.“ Die Nettoeffekte seien oft positiv, insbesondere wenn Sprachförderung und Qualifikationsmaßnahmen greifen.
Mythos 3: „Migration löst automatisch das Altersproblem“
Demografisch gesehen schrumpft die erwerbsfähige Bevölkerung Deutschlands rapide. Manche argumentieren, Migration könne diesen Trend stoppen. Tatsächlich hilft Zuwanderung, den Rückgang abzufedern – aber nicht vollständig aufzuhalten. Eine Berechnung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zeigt: Um das heutige Niveau der Erwerbsbevölkerung zu halten, müsste Deutschland jährlich rund 400.000 Menschen netto aufnehmen – ein unrealistischer Wert ohne massive soziale Umbrüche. Migration ist also Teil der Lösung, aber kein Allheilmittel.
Mythos 4: „Nur Fachkräfte helfen dem Arbeitsmarkt“
Ein weiterer Irrtum besteht darin, nur hochqualifizierte Migranten seien wirtschaftlich nützlich. Die Realität ist: Auch geringqualifizierte Arbeitskräfte werden dringend gebraucht. Laut Bundesagentur für Arbeit fehlen allein in der Gastronomie und Logistik mehr als 300.000 Beschäftigte. Migrant:innen, die bereit sind, diese Jobs zu übernehmen, tragen entscheidend zur Stabilität dieser Sektoren bei. Die Pflegebranche ist ein Beispiel: Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund unter Pflegekräften liegt bereits bei über 20 Prozent.
Politikbezug: Dobrindt & die symbolische Härte
In einem viel beachteten Interview kritisierte der renommierte Migrationsforscher Hein de Haas die Vorschläge von CSU-Politiker Alexander Dobrindt als „komplette Illusion“. Rückführungszentren in Drittstaaten seien juristisch wie logistisch kaum realisierbar. De Haas sagte: „Politiker erwecken den Eindruck, Migration ließe sich wie ein Wasserhahn abdrehen. Das ist Unsinn.“ Migration sei ein strukturelles Phänomen, das auf Arbeitsmarktbedingungen, Netzwerkeffekten und geopolitischen Dynamiken beruhe.
Auch die Grünen-Politikerin Katharina Dröge kritisierte Dobrindts Kurs als populistische Symbolpolitik: „Wer glaubt, mit Rückführungen das Problem zu lösen, ignoriert die Realität. Die wenigsten Menschen kommen ohne Grund – sie fliehen vor Krieg, Verfolgung oder ökonomischer Not.“ Laut einer ZDF-Analyse stammen die meisten Asylbewerber derzeit aus Syrien, Afghanistan und der Türkei – Staaten, in denen demokratische und humanitäre Standards teils massiv verletzt werden.
Wirtschaft & Arbeitsmarkt: Ein realistischer Blick
Geringqualifizierte Jobs: Ohne Zuwanderung droht der Stillstand
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) warnt: Ohne gesteuerte Zuwanderung droht der Zusammenbruch ganzer Wirtschaftsbereiche. Besonders betroffen: Gebäudereinigung, Bau, Pflege, Einzelhandel. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung benötigen deutsche Unternehmen bis 2035 rund 7 Millionen neue Arbeitskräfte – ein Drittel davon könnte durch Migration gedeckt werden.
Ein Beispiel aus der Praxis: In der Logistikbranche lag der Anteil ausländischer Beschäftigter 2022 bereits bei 26 Prozent – Tendenz steigend. Unternehmen wie DHL oder Amazon wären ohne migrantische Arbeitskräfte kaum mehr betriebsfähig.
Langfristige Effekte & Integration
Laut dem IAB zeigen Langzeitstudien: Je länger Migrant:innen in Deutschland leben, desto höher ihre Erwerbsbeteiligung. Im Jahr 2022 waren etwa 59 Prozent der in den Vorjahren eingewanderten Geflüchteten erwerbstätig oder in Ausbildung. Fratzscher fasst zusammen: „Migration wirkt nicht sofort – sie braucht Zeit, aber sie zahlt sich aus.“ Ein Problem bleibt allerdings das sogenannte „Skill Downgrading“: Viele Einwanderer arbeiten unterhalb ihres Qualifikationsniveaus, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden oder Sprachbarrieren bestehen.
Fachkräftestrategien und politischer Reformbedarf
Deutschland schneidet im internationalen Vergleich bei der Anwerbung qualifizierter Fachkräfte eher schlecht ab. Die OECD listet die Bundesrepublik im Mittelfeld, weit hinter Kanada oder Australien. Gründe: Bürokratie, Sprachhürden, langsame Visavergabe. Europaabgeordnete wie Damian Boeselager fordern daher eine „radikale Vereinfachung“ der Fachkräfteeinwanderung, etwa durch digitale Verfahren, zentrale Anerkennungsstellen und enge Kooperation mit Herkunftsländern.
Empfehlungen & Ausblick
Eine nachhaltige Migrationspolitik braucht Differenzierung und Ehrlichkeit. Mythen über Migration lassen sich nur durch faktenbasierte Aufklärung entkräften. Wichtig wäre eine klare Trennung zwischen humanitärer Aufnahme (z. B. Asyl) und arbeitsmarktgesteuerter Zuwanderung. Politisch sollte der Fokus weniger auf Abschottung und mehr auf Gestaltung liegen: Integration, Qualifizierung und langfristige Bleibeperspektiven zahlen sich gesamtgesellschaftlich aus.
Zugleich muss die Wirtschaft einbezogen werden – nicht nur als Profiteur, sondern auch als Gestalter. Betriebe, die migrantische Fachkräfte anwerben, müssen sich an deren Integration beteiligen. Programme zur Sprachförderung, Anerkennung von Abschlüssen und beruflicher Qualifikation sollten stärker gefördert und entbürokratisiert werden.
Realität in einer globalisierten Welt
Migration ist kein Krisenphänomen, sondern eine Realität in einer globalisierten Welt. Die deutsche Migrationspolitik steht an einem Scheideweg: Entweder sie bleibt Symbolpolitik mit unrealistischen Versprechungen, oder sie entwickelt sich zu einem Instrument aktiver, wirtschaftsorientierter Gestaltung. Wer Mythen durch Fakten ersetzt, erkennt: Migration kann ein Gewinn sein – wenn sie klug gesteuert, ehrlich debattiert und menschlich gestaltet wird.